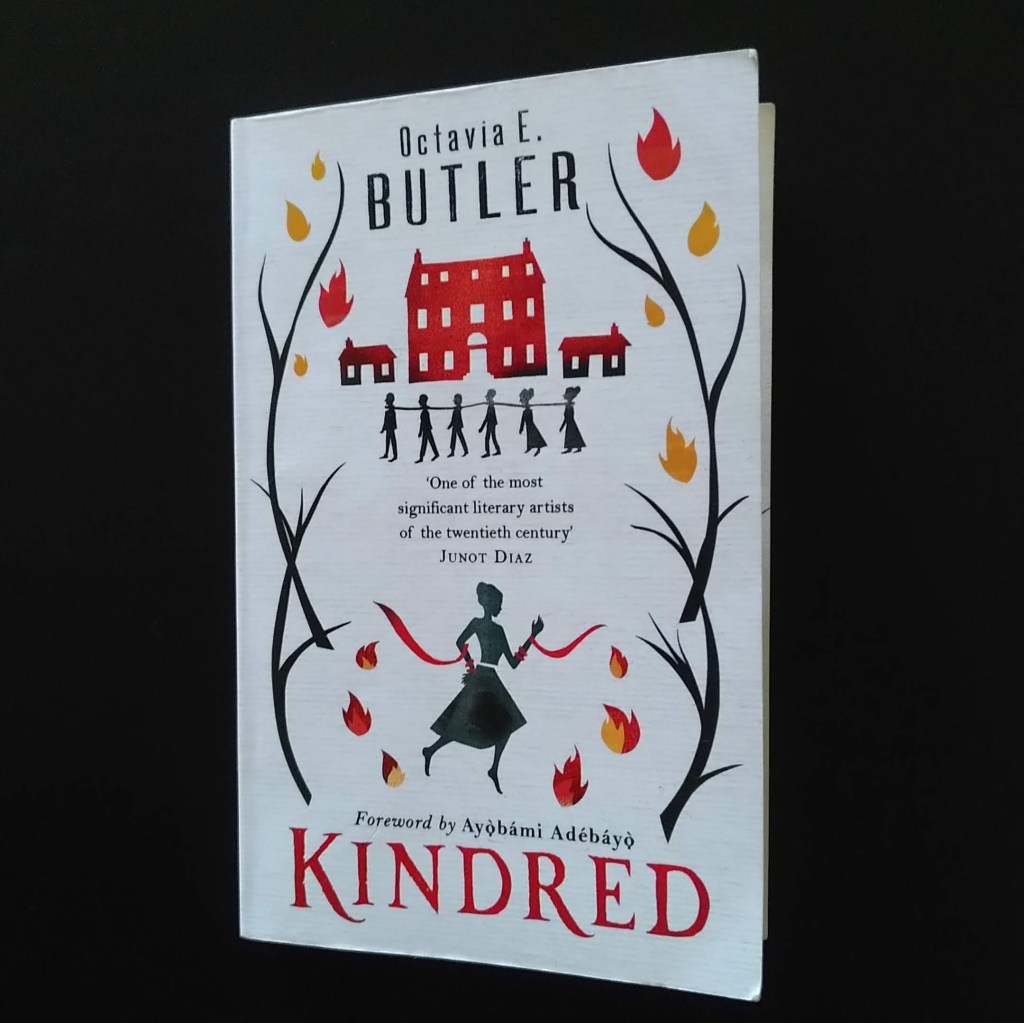
Octavia E. Butler gehört zu den Klassikern der Schwarzen Literatur, sie ist feministisch und avantgardistisch zugleich. Ihr Buch Kindred (1979) setzt sich mit der Sklaverei in einem Genre auseinander, das zunächst ungewöhnlich anmuten mag. Butler ist vor allem als Science-Fiction-Autorin bekannt, sie erhielt die drei bedeutenden Literaturpreise für Science-Fiction und Fantasy (den Locus Award, den Hugo Award und den Nebula Award) und wurde als erste Autorin in diesem Genre auch mit dem prestigeträchtigen Mac Arthur Fellowship ausgezeichnet. Die Autorin selbst weist darauf hin, dass es sich im Unterschied zu ihren anderen Werken bei Kindred trotz der Zeitreisen nicht um Science fiction handelt (es fehle hier die science). Ihr Werk wurde u.a. im Kontext des Afrofuturismus, der Cyborg-Theorie (Donna Harraway 1985) und des Konzepts des Black Atlantic (Paul Gilroy 1993) rezipiert.
Dass Zeitreisen und das Science-Fiction-Genre sich durchaus für historisch brisante Themen eignen, hat auch Kurt Vonnegut mit Slaughterhouse Five (1969) gezeigt, wo Reisen auf den Planeten Tralfamador Teil der Auseinandersetzung mit den Luftangriffen auf Dresden im Zweiten Weltkrieg sind. Gerade für marginalisierte, diskriminierte und von Rassismus betroffene Personen und Gruppen bieten literarische Genre-Texte, die Popkultur im Allgemeinen und künstlerisch-politische Bewegungen wie der Afrofuturismus jedoch eine besonders vielversprechende Anschlussstelle – sie repräsentieren nicht nur die aus den dominierenden Diskursen ausgeschlossenen gesellschaftlichen Randpositionen, sondern ermöglichen darüber hinaus auch eine breitere Rezeption und Debatte als die durch verschiedene Gate-Keeping-Mechanismen eher in sich abgeschlossenen akademischen Diskurse.
Octavia Butlers Kindred handelt von der sich gerade etablierenden Schriftstellerin Dana. Diese hält sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser, wie auch ihr Partner Kevin, den sie bei einem der Jobs kennenlernt. Auch Kevin ist Schriftsteller. Der Anfang des Textes führt die Leser:innen zunächst auf eine falsche Fährte: Dana hat auf ihrer letzten Zeitreise einen Arm verloren und muss nun im Krankenhaus die Polizei davon überzeugen, dass Kevin nicht die Verantwortung dafür trägt. Was zunächst danach aussieht, als wäre es eine Szene, in der häusliche Gewalt verschwiegen wird, hat einen ganz anderen Hintergrund.
Dana, die im Jahr 1976 lebt, wird durch Zeitreisen immer wieder auf eine Plantage in Maryland zu Beginn des 19. Jahrhunderts versetzt. Sie weiß, dass ihre Großmutter Hagar 1831 dort geboren ist. Dana wird zu verschiedenen Zeitpunkten in die Vergangenheit geholt, um Rufus – den Sohn eines Plantagenbesitzers – seit seiner Kindheit vor Gefahren zu beschützen. Von Anfang an ist sie selbst in Gefahr, da sie zu dieser Zeit auch selbst als Sklavin wahrgenommen wird. Sie lernt dort Alice und andere Sklav:innen kennen. Alice sieht ihr sehr ähnlich. Dana erkennt in ihr eine Verwandte und schon bald wird ihr bewusst, dass sie die Zeitreisen unternimmt, um ihren Vorfahr:innen und damit auch sich selbst das Leben zu retten. Immer wieder sind ihr Leben und das Leben ihrer noch ungeborenen Großmutter Hagar in Gefahr. Wenn Dana selbst in Lebensgefahr gerät, reist sie wieder zurück in das Kalifornien der 1970er Jahre.
Mit den Zeitreisen schafft Octavia Butlers Roman eine andere Leseerfahrung als es etwa historische Romane tun, auch von Erinnerungstexten unterscheidet sie sich. Die Erfahrung der Sklaverei, das Leben im Körper einer zur Sklavin degradierten Frau, sind für Dana nicht bloße Vergangenheit, sie sind auch kein Projekt der Rekonstruktion oder Imagination. Dana wird innerhalb der fiktiven Handlung direkt aus der Gegenwart in das Leben im 19. Jahrhundert zurückversetzt – das ruft einen gewissen Realitätseffekt hervor:
I had seen people beaten on television and in the movies. I had seen the too-red blood substitute streaked across their backs and heard their well-rehearsed screams. But I hadn’t lain nearby and smelled their sweat or heard them pleading and praying, shamed before their families and themselves. I was probably less prepared for the reality than the child crying not far from me. In fact, she and I were reacting very much alike. My face too was wet with tears.
Octavia Butler: Kindred
In dieser Textstelle wird deutlich, dass die Darstellung von Gewalt in Film und Fernsehen nicht nur nicht genügt, um zu wissen, wie es ist, sie zu erleben, sondern dass die Beschäftigung damit und die Kenntnis davon, nicht im Geringsten darauf vorbereitet, sie zu erleben und damit auf emotionaler Ebene umzugehen. Durch diese Rahmung wird der Anspruch an Fiktion, die Realität von Gewalterfahrungen vermitteln zu können, direkt zu Beginn zurückgewiesen. Obwohl Dana durch die Zeitreise die Gewalt unmittelbar erlebt, verweigert sich Butlers Roman einer Deutung, die suggeriert, ein Werk der Fiktion oder eine andere Art von medialer Darstellung könne die Sklaverei erfahrbar machen. Mit dem Mittel der Zeitreise macht Butler deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte diese weder verändern kann, noch darauf vorbereit, mit Gewalt umzugehen. Butler stellt die Frage, was passiert, wenn jemand mit dem Wissen der Gegenwart in die Vergangenheit reist – diese rein hypothetische Frage lässt sich besonders gut im gewählten Genre stellen.
Der Text imaginiert, wie die Realität für Dana als Schwarze Frau ganz konkret aussehen könnte, wenn sie zu Zeiten der Sklaverei leben würde. In der Vergangenheit kann Dana jederzeit von weißen Patrouillen aufgegriffen werden, sie wird als Besitz anderer Menschen betrachtet und ist Bestrafungen und absoluter Willkür ausgesetzt. Die Unterschiede zur Gegenwart werden klar benannt: „I was working out of a casual labor agency – we regulars called it a slave market. Actually, it was just the opposite of slavery.“ Dana erkennt gleichzeitig, wie leicht die Sklaverei normalisiert wurde („I never realized how easily people could be trained to accept slavery.“) und wie groß die Bereitschaft war, für Geld und Macht andere Menschen zu dehumanisieren. Butlers Kritik ist intersektional, sie thematisiert die Verschränkung zwischen Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus – und zwar auf unheimlich präzise und gleichzeitig subtile Art und Weise.
Als sich Dana mit den anderen Sklav:innen auf der Plantage anfreundet, erfährt sie von Sarah, dass Mr. Weylin Sarahs Kinder verkauft hat. Als sie nach dem Grund fragt, bekommt sie folgende Antwort:
‚She wanted new furniture, new china dishes, fancy things you see in that house now. What she had was good enough for Miss Hannah, and Miss Hannah was a real lady. Quality. But it wasn’t good enough for white-trash Margaret. So she made Marse Tom sell my three boys to get money to buy things she didn’t even need!‘ ‚Oh.‘ I couldn’t think of anything else to say.
Octavia Butler: Kindred
Die Verschränkungen zwischen Rassismus und Patriarchat zeigen sich auch darin, wie Rufus mit den beiden Schwarzen Frauen Alice und Dana umgeht. Während Alice seine große Liebe war, bevor sie sich in einen anderen Mann verliebte, wird Dana zu seiner Freundin. Beiden Frauen zwingt er seine Liebe bzw. Freundschaft auf und verlangt absolute Loyalität und Unterwerfung. Wenn sie nicht tun, was er will, fordert er es durch Gewalt ein und schreckt weder vor körperlicher Bestrafung noch vor Vergewaltigung zurück.
Gerade die Situation von Dana als Frau bildet in Bezug auf die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen einen beängstigenden Echoraum in der Gegenwart: Die Erfahrung, als Frau kein Recht auf den eigenen Körper zu haben und von intellektueller Teilhabe ausgeschlossen zu sein, klingen in Vorstellungen über die Ehe oder über Danas Möglichkeiten als weibliche Autorin wieder. Besonders aufschlussreich sind die Passagen, die vom Schreiben handeln. Darin zeigt sich, wie subtil es Butler gelingt, bestimmte Situationen in ihrer Parallelität und gleichzeitigen Unterschiedlichkeit herauszuarbeiten und dahinter eine Leerstelle aufscheinen zu lassen: die der Schwarzen schreibenden Frau.
Sowohl Dana als auch ihr Partner und späterer Ehemann Kevin sind Schriftsteller:innen. Kevin wird später so erfolgreich, dass sie sich von seinem Geld ein Haus kaufen können. Die Heirat zwischen den beiden wird zur Prüfung auf zweierlei Art und Weise: Einerseits erfahren sie keine Unterstützung von ihren Familien (Kevins Schwester ist aus rassistischen Gründen gegen eine Heirat mit einer Schwarzen Frau, aber auch Danas Onkel ist gegen die Heirat mit Kevin). Fast beiläufig ergibt sich direkt nach dem Heiratsantrag ein aufschlussreicher Dialog zwischen Dana und Kevin.
Durch die geplante Hochzeit schwebt Kevin vor, dass sie sich nun – als zukünftige Ehefrau – um seine Manuskripte kümmern könnte. Auf der Gegenwartsebene wehrt Dana sich dagegen, zu Kevins Sekretärin degradiert zu werden. In der Vergangenheitsebene bleibt ihr nichts anderes übrig, als Kevin als ihren „Master“ auszugeben und dem Wunsch von Rufus nachzukommen, Briefe für ihn zu schreiben. Sie macht dennoch beiden Männern deutlich, dass dies genau die Art von Tätigkeit ist, die sie ihr Leben lang vermeiden wollte. Die Dynamik zwischen der Schwarzen Frau und den beiden weißen Männern geht über Rassismuskritik hinaus, sie sollte auch als Kritik am Patriarchat gelesen werden. Das Buch zeigt auf, dass diese Dynamik im Patriarchat wurzelt, welches eben nicht auf weiße Männer beschränkt ist.
Dies wird deutlich, wenn der Roman mit Blick auf seine Entstehungszeit in den 70er Jahren gelesen wird und die Lage Schwarzer (scheibender) Frauen zu dieser Zeit betrachtet wird. Philip Miletic arbeitet in seinem Aufsatz „Octavia E. Butler’s Response to Black Arts/Black Power Literature and Rhetoric in ‚Kindred‘“ die dafür relevanten Kontexte detailliert heraus. So wird auch in der Black Power Bewegung Frauen nur eine sekundäre, unterstützende Rolle zugewiesen – im Zentrum stand die Vorstellung dominanter Männlichkeit (vgl. dazu Miletic, 270f.). Damit übt Butler – indirekt – auch Kritik an der Lage Schwarzer Frauen innerhalb von Schwarzen Bewegungen.
Vor diesem Hintergrund wird die Rolle von Dana, die in den 70er Jahren daran arbeitet, Schriftstellerin zu werden, besonders brisant. Interessant ist, wie wenig Butler daran liegt, das Schreiben selbst zu überfrachten und etwa als Medium der Vergangenheitsbewältigung oder der Selbsterkenntnis zu stilisieren. Dana muss darum kämpfen, nicht auf die Rolle der Sekretärin reduziert zu werden, die ihr von dem männlich dominierten Umfeld immer wieder zugewiesen wird, und sich selbst einen Raum zu schaffen, in dem sie kreativ tätig sein kann.
Dana kann die Zeitreisen nicht selbst kontrollieren, sie stellt jedoch fest, dass sie immer dann in die Gegenwartsebene zurückreist, wenn sie so stark gefährdet ist, dass ihr der Tod droht. Dadurch gewinnt der Text an unglaublicher Schärfe in Situationen, in denen sie sich zwar fühlt, als wäre sie kurz davor zu sterben, aber in denen sie trotz Schmerz und Verzweiflung doch noch weit davon entfernt ist. Dana fragt sich immer wieder, wann der Moment gekommen ist, um durchzudrehen, verrückt zu werden, wegzulaufen oder um sich zu wehren, etwas zu entgegnen, bereit zu sein, zu töten. Dies kann sie allerdings nicht tun, wenn sie nicht bereit ist, im Zweifel auch ihre eigene Geburt zu verhindern – sie muss sich wiederholt zwischen der Komplizenschaft mit Rufus und ihrem eigenen Leben entscheiden. Die breite Literatur zu Butlers Kindred lädt dazu ein, sich mit verschiedenen Interpretationen von Kindred auseinanderzusetzen. Das Buch wieder und wieder zu lesen, lohnt sich auf jeden Fall.
Butler, Octavia E.: Kindred, London: Headline 2018 (1979).
Gilroy, Paul: The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press 1993.
Haraway, Donna: Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980’s. In: Socialist Review 80. 1985.
Miletic, Philip: Octavia E. Butler’s Response to Black Arts/Black Power Literature and Rhetoric in ‘Kindred.” In: African American Review, vol. 49, no. 3, 2016, pp. 261–75.
Vonnegut, Kurt: Slaughterhouse-Five, or, The Children’s Crusade: A Duty-Dance with Death. New York, NY: Delacorte 1969.
Womack, Y. L.: Afrofuturism: The world of black sci-fi and fantasy culture. Chicago Review Press 2013.


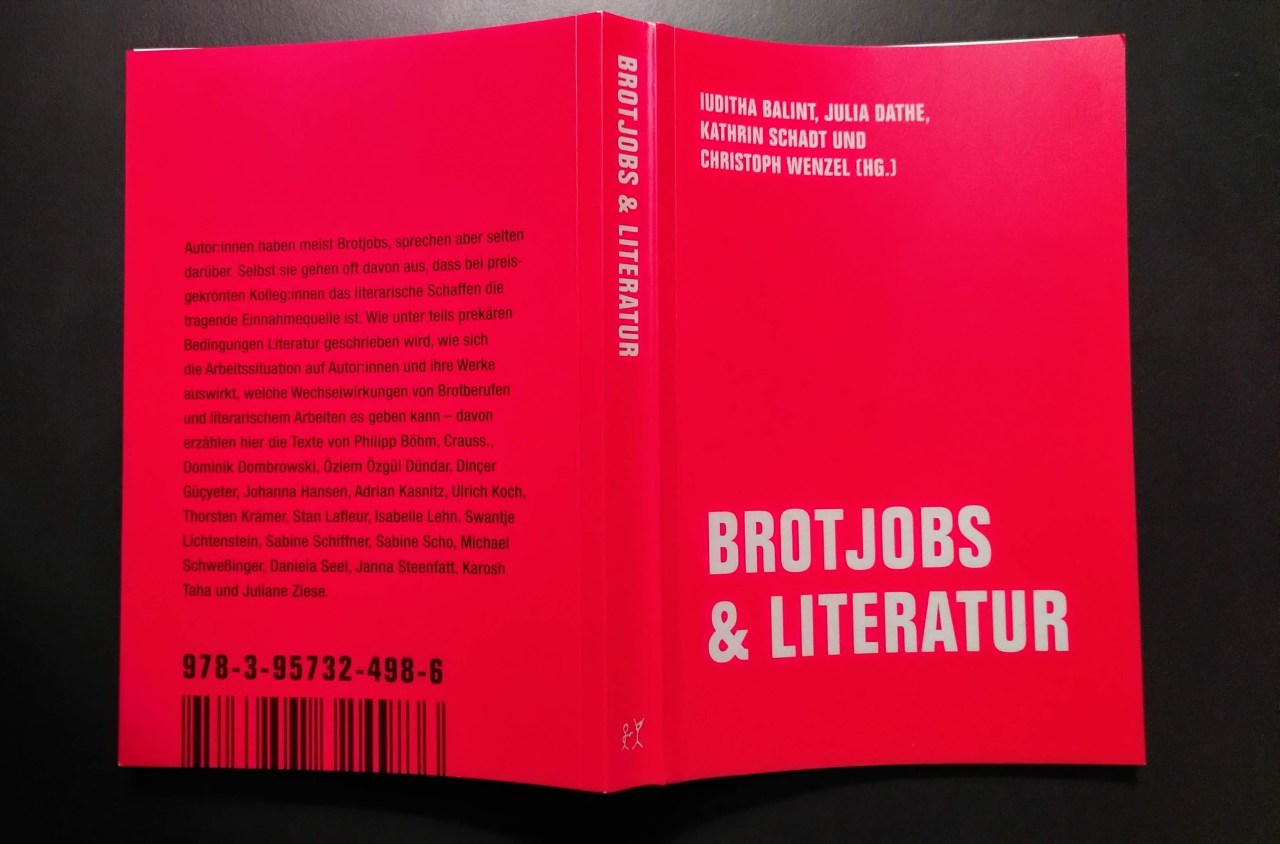
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.