Die Geschwister
Durch die Neuausgabe von Die Geschwister ist Brigitte Reimann wieder zum Thema geworden, auch durch die Biografie von Carolin Würfel (Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Maxie Wander – Brigitte Reimann – Christa Wolf. Berlin: Hanser Berlin 2022) erfährt die Autorin neue Resonanz. Bei Arbeiten an einem Haus in Hoyerswerda wurde ein Heft der handschriftlichen Urfassung von Die Geschwister gefunden. Der Aufbau-Verlag brachte auf dieser Grundlage eine „ungekürzt[e], politisch ungeschönt[e] Fassung“ heraus. Wenn das Nachwort etwas genauer betrachtet wird, lässt sich leider nicht mehr so leicht rekonstruieren, um welche Version es sich bei der Neuveröffentlichung nun eigentlich handelt – um die von Reimann ursprünglich intendierte Erzählung (vor den Veränderungen durch Verlag und DDR-Ministerium für die Publikation) oder um die nachträglich von Reimann selbst redigierte Version, als sie sich politisch bereits anders positioniert hatte. Im Buch heißt es:
Rückgängig gemacht wurden alle Streichungen bzw. Änderungen, die erkennen lassen, dass politisch Missliebiges geglättet oder der frische Erzählton Reimanns nach damaliger Mode ‚literarisiert‘ werden sollte […]. Die nachträglichen Korrekturen der Autorin von 1969 finden grundsätzlich Berücksichtigung […].
Brigitte Reimann, Die Geschwister, Berlin: Aufbau 2023, Zu dieser Ausgabe, S. 212.
Auch wenn es sich hier um keine kommentierte Studienausgabe handelt, wäre durchaus schön gewesen, zu erfahren, welche Stellen ursprünglich anders gemeint waren und welche nachträglich korrigiert worden sind. Es handelt sich demnach um eine Fassung, die irgendwo zwischen dem liegt, was Reimann im Sinn hatte, als sie das Buch schrieb und dem, was sie zu einem Zeitpunkt, als sie „politisch endgültig desillusioniert“ war und „eine andere, eine differenziertere Sicht auf die DDR gewonnen“ (ebd. 207) hatte, gern aus dem Buch gemacht hätte. Dadurch verliert sich in der Lektüre die Distanz, mit der sich DDR-Literatur sonst wohlwollend lesen lässt – es lässt sich nicht (mehr) einfach annehmen, dass die Autorin das, was sie wirklich schreiben wollte, nicht schreiben durfte oder konnte. Der Text kann vor diesem Hintergrund nicht mehr als Kompromiss gelesen werden, sondern muss beim Wort genommen werden. Dies wird den Lesenden allerdings durch die Entscheidung des Verlags, nicht zu kennzeichnen, welche Korrekturen genau vorgenommen wurden, wiederum erschwert. Reimanns Text wird in dieser Neuausgabe so präsentiert, als ließe er sich kontextlos als eine Geschichte über zwei Geschwister, die sich über das richtige politische System streiten, lesen.
Das im Nachwort stehende Lob, das Buch sei „eine zeitlose Geschichte über Zugehörigkeit und Individualität, über Loyalität und Mut, für die eigene Vorstellung von Freiheit und Glück einzustehen“, ist völlig absurd, wenn es vor dem Hintergrund ausgesprochen wird, dass in dieser Fassung lediglich kleinere Spitzen Reimanns, die herausgestrichen worden sind (so etwa die „männermordende Taille“ auf S. 66), nun wieder im Text stehen dürfen oder wenn gesagt wird, dass die Schwester in dieser Fassung nun mehr Zweifel äußern darf als in der offiziellen. Zweifellos lohnt sich die Lektüre von Brigitte Reimanns Texten auch heute noch aus verschiedenen Gründen, auf die ich weiter unten gern eingehen möchte, dennoch ist es erstaunlich, wie heutzutage ein Buch abgefeiert wird, in dem es darum geht, dass eine Schwester ihren geliebten Bruder Uli (und eben nicht nur den anderen Bruder Konrad, der völlig negativ als oberflächlicher Kapitalist gezeichnet wird) dafür verurteilt, dass er in den Westen gehen möchte.
Gerade in dieser Fassung, die laut Verlag die von Reimann intendierte Wirkung entfaltet, wirkt es umso grotesker, dass Elisabeth die Tatsache, dass der DDR-Staat ihrem Bruder die Ausbildung bezahlt hat oder dass es solche Fachkräfte wie ihn zum Aufbau des sozialistischen Staates braucht, über dessen persönliche Wünsche stellt und dass sie für ihre Ideale die bis dahin liebevolle Beziehung zu ihrem Bruder opfert, dass sie erwägt, ihn nicht nur zu verraten, sondern sogar anzuzeigen. Dadurch, dass sich Elisabeth im achten Kapitel als mutige Kämpferin gegen die Partei und die etablierten Kollegen inszeniert, wird innerhalb der Erzählung der Eindruck erzeugt, sie kämpfe gegen verkrustete Strukturen in der Partei, sei moralisch auf der richtigen Seite. Elisabeth ähnelt in ihrer Haltung der Heldin aus Franziska Linkerhand (1974), die in dem später entstanden gleichnamigen Roman die sozialistischen Ideale gegen die Wirklichkeit verteidigt.
Beide Figuren werden als mutige Kämpferinnen für die gute Sache inszeniert – wenn sie dabei ihre Ideale über die Menschlickheit stellen, mag das bei negativ gezeichneten Figuren (wie Heiners in der Bergemann-Geschichte in Die Geschwister) als kritisch oder subversiv ausgelegt werden, wenn dieselbe versachlichende, objektifizierende Perspektive jedoch auf den eigenen Bruder (und hier kommt es weniger auf den eigenen Bruder als auf den geliebten Bruder an) ausgeweitet wird, wirft das die Frage auf, wie kritisch die idealisierende und moralisierende Haltung von Elisabeth eigentlich ist bzw. warum sie heutzutage auf diese Art und Weise gedeutet wird.

Weiterhin selten: Eine weibliche Stimme, die über Arbeit spricht
Beide Romane – Franziska Linkerhand und Die Geschwister – sind aus heutiger Perspektive dennoch erfrischend zu lesen, sie entfalten ihre kritische Wirkung jedoch auf einer anderen Ebene. Auch heute noch ist eine selbstbewusste weibliche Stimme, die in einer von Männern dominierten Arbeitswelt eine nicht prekäre Arbeit hat und dort auch für sich spricht und für ihre Ideale einsteht, ziemlich selten. Eine Frau, die zur Arbeit kommt und den Männern dort deutliche Ansagen macht, Konflikte austrägt, im Zweifel auch, wenn sich das nachteilig für sie auswirken kann, findet sich doch eher selten in der Gegenwartsliteratur. Wenn Frauen in Texten, die von und in der Arbeitswelt handeln, eine Rolle spielen, dann geht es oft um Konflikte, die sich durch das Vereinbarkeitsproblem von Arbeit und Care-Tätigkeiten ergeben oder um Kritik an Arbeitsverhältnissen im Kapitalismus generell, manchmal auch um Frauen, die als Schreibende und/oder Kreativschaffende tätig sind (auch hier sind die Themen dann oft Prekarität oder Abhängigkeit vom Partriarchat und/oder Kulturbetrieb).
Franziska Schößler schließt ihr Buch Femina Oeconomica: Arbeit, Konsum und Geschlecht in der Literatur. Von Goethe bis Händler (Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang 2017) mit der Feststellung, dass
Literatur also diejenigen Aspekte von (weiblicher) Arbeit, die beliebten literarischen Darstellungsverfahren, Figurenkonzepten und künstlerischen Selbstverständnissen entgegenkommen – den Schöpfungs- und Kreativitätsmythos, emotionale und ästhetische Arbeit, den Liebesdiskurs, Begehren, weibliche Körperlichkeit und Sexualität –, und zwar in kritischer wie affirmativer Hinsicht, [profiliert]. (S. 288f.)
Dass eine weibliche Protagonistin Karriere macht, dass sie darüber hinaus auch ein reflektiertes Verhältnis zu ihrer Arbeit und einen gewissen Anspruch daran hat, dass sie Konflikte nicht scheut, um ihren Vorstellungen treu zu bleiben, ist auch 60 Jahre nach dem Erscheinen von Die Geschwister eher selten – als Beispiel in der Gegenwartsliteratur ließe sich etwa Lucy Frickes Die Diplomatin nennen. Dominant sind weiterhin andere Themen – sicherlich auch als Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben – Kritik am Kapitalismus, Darstellung weiblicher Arbeit als Hausarbeit bzw. Care-Arbeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen.
In dem aufgrund des frühen Todes der Autorin Fragment gebliebenen Roman Franziska Linkerhand geht es vor allem um die Diskrepanz zwischen Plänen, Träumen und Idealen und dem Alltag, der sich in der realen Arbeitswelt dann ganz anders gestaltet. In einem Brief schreibt Reimann über die Fabel:
Da kommt ein Mädchen, jung, begabt, voller leidenschaftlicher Pläne, in die Baukastenstadt und träumt von Palästen aus Glas und Stahl – und dann muß sie Bauelemente zählen, (…) sich mit tausend Leuten herumschlagen (…) und die Heldentaten bestehen darin, daß man um ein paar Zentimeter Fensterbreite kämpft, und alles ist so entsetzlich alltäglich, und wo bleiben die großen Entwürfe der Jugend? Schließlich hört man auf zu bocken und macht mit … Eine traurige Geschichte, und sie passiert jeden Tag. Ich kann das Wort ‚enthusiastisch‘ schon nicht mehr hören. Manchmal geht sogar mir der Treibstoff aus, und ich möchte aufhören, mich dauernd zu streiten mit Leuten, die ja doch nie Fehler machen, nie sich irren und Dich behandeln wie Hohepriester einen Laienbruder. Sie sagen ‚Perspektive‘ und ich sage ‚Heute‘. Nun ja, wir haben so unsere Verständigungsschwierigkeiten.
„Briefwechsel mit Annemarie Auer“. In: Was zählt, ist die Wahrheit. Briefe von Schriftstellern der DDR. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1975. S.290–330.
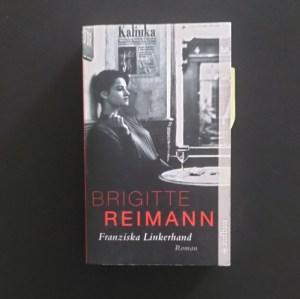
Vielleicht interessiert sich die Gegenwartsliteratur generell nicht für Arbeit – zumindest nicht, wenn es nicht um kreative Selbstverwirklichung oder Aufstiegsversprechen in der Wirtschaft und Finanzindustrie (oder um beides zusammen beim Gründen von Start Ups) geht. Oder um das Gegenteil dessen: die Kritik an prekärer Arbeit und am Kapitalismus generell. Eine Leerstelle bleibt die Beschreibung von Frauen, die professionellen Arbeitsverhältnissen nachgehen und sich damit produktiv und kritisch auseinandersetzen. Auch das wäre ein Grund, Brigitte Reimann zu lesen.
Brigitte Reimann: Die Geschwister, hrsg. von Angela Drescher und Nele Holdack. Berlin: Aufbau 2023,



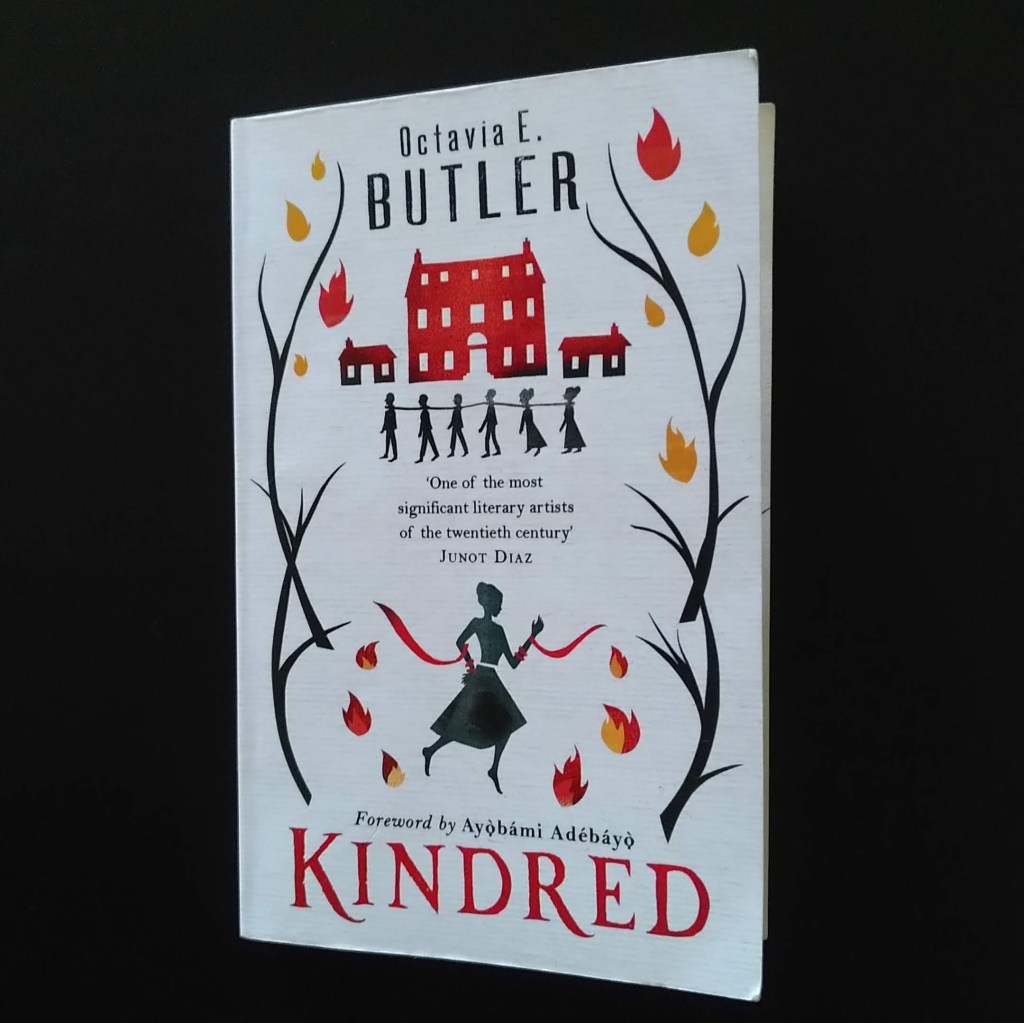

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.